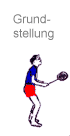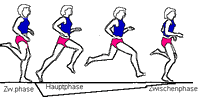| "...Charakteristisch
für die Vorbereitungsphase ist ihre Bedeutung: sie dient der Schaffung
optimaler Voraussetzungen der optimalen Vorbereitung der in der nachfolgenden
Hauptphase auszuführenden Aktionen.
Diese
optimalen Voraussetzungen zeigen beim Menschen weitgehende Übereinstimmung:
Man führt eine "Ausholbewegung" aus, die gegen die eigentlich gewollte
Bewegungsrichtung gerichtet ist.
Wenn
wir einen Ball oder einen Speer weit werfen wollen, wenn wir nach oben
oder aus der Schrittstellung nach vorne springen wollen oder wenn wir am
Reck einen Umschwung ausführen wollen, dann führen wir vorweg
in die Gegenrichtung eine Ausholbewegung aus.
Man
kann einen Ball natürlich auch ohne Ausholbewegung werfen und man
kann auch ohne Ausholbewegung einen Umschwung beginnen. Die Folgen sind
jedoch leicht erkennbar: Die nachfolgende Wurfbewegung erbringt eine geringere
Leistung und das Umschwingen kann unter Umständen sogar misslingen.
An beiden Beispielen wird deutlich, dass die Vorbereitungsphase Nachfolgendes
begünstigt.
Werden
die Bewegungen. in dieser Phase allerdings übertrieben, wird also
z. B. zum Werfen extrem weit ausgeholt oder zum Umschwingen sehr hoch aufgeschwungen,
so kann die nachfolgende Leistung wieder schlechter werden. Erklärbar
ist dies wenn man die Gründe aufsucht, die für eine (wohldosierte)
Ausholbewegung sprechen. Der erste Grund ist in dem möglichst optimalen
Beschleunigungsweg zu sehen. Je größer die Ausholbewegung ist,
desto länger wird auch der anschließend ausnützbare Beschleunigungsweg.
Damit verlagert sich auch die Dauer der Krafteinwirkung, und dies führt
wiederum zu einer größeren Endgeschwindigkeit des beschleunigten
Körperteils bzw. Sportgeräts. Nun ist aber möglich, dass
je nach Trainingszustand die entsprechende Muskulatur bei einem langen
Beschleunigungsweg ermüdet und daher nur noch geringere Kräfte
aufbringen kann. Der Vorteil des längeren Beschleunigungswegs ist
dann mit dem Nachteil einer überforderten Muskulatur verbunden. Die
Ausholbewegung kann daher nicht beliebig vergrößert werden.
Ein zweiter Grund wird in der höheren Kraft gesehen die man durch
eine Ausholbewegung zu Beginn der Hauptphase bereitstellen kann. Da die
Ausholbewegung entgegengesetzt zur Hauptbewegung verläuft, muss sie
abgebremst und in eine neue Richtung übergeleitet werden..."
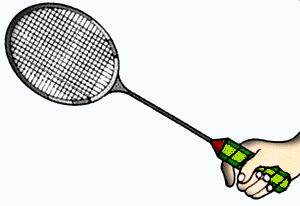 
Zur Hauptphase:
"Das
Kernstück einer sportlichen Bewegung ist die Hauptphase.
Ihre
Bedeutung liegt in der unmittelbaren Bewältigung der entsprechenden
Bewegungsaufgabe; ihre Funktion ist, die gestellte Aufgabe zu lösen.
Wenn
wir einen möglichst hohen Schlusssprung oder einen möglichst
weiten Stoß oder eine möglichst schnelle Fortbewegung im Wasser
oder auf dem Eis erreichen wollen, dann werden diese Aufgaben durch die
in der Hauptphase ausgeführten Aktionen gelöst: durch das möglichst
schnelle Strecken in Sprung-, Knie- und Hüftgelenk beim Springen,
durch die vom Körper weg gerichtete Armstreckung beim Stoßen
oder durch die nach hinten gerichteten Arm- bzw. Beinbewegungen im Wasser
oder auf dem Eis. Sehr allgemein betrachtet, kann man im Sport zwei Aufgabentypen
unterscheiden, die in den jeweiligen Hauptphasen zu lösen sind. Der
eine Typ umfasst diejenigen Aufgaben, in denen man nur sich selbst einen
Bewegungsimpuls zu erteilen hat, um von der einen zu einer anderen Ortsstelle
zu kommen, um also sogenannte Lokomotionen auszuführen. Beispiele
hierfür sind das Laufen, das Springen, das Schwimmen oder Rudern.
Beim
zweiten Typ steht nicht die Bewegung des eigenen, sondern die eines anderen
Körpers im Vordergrund. Der eigene Körper oder auch nur Teile
des eigenen Körpers, die Hand, der Fuß, beim Kopfball auch der
Kopf, müssen so bewegt werden, dass das mit dem Körperteil kontaktierende
Objekt in gezielter Weise bewegt wird. Beispiele hierfür sind das
Weitwerfen, das Kicken, das Schlagen des Tennisballs oder des (Box-) Gegners.
.."
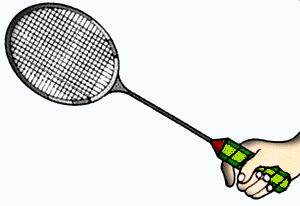 
Als
Endphase kennzeichnet man jenen Bewegungsabschnitt, in dem die Aktionen
der Hauptphase in einen Gleichgewichtszustand übergeleitet werden.
Dieser
Gleichgewichtszustand kann ein Zustand relativer Ruhe, er kann aber auch
nur ein kurzzeitiges Durchgangsstadium vor dem Beginn einer neuen Bewegung
sein. Die eigentliche Bewegungsaufgabe ist mit dem Ende der Hauptphase
gelöst, die Kugel oder der Speer hat z. B. die Hand verlassen, der
Sportler befindet sich jedoch noch in einem Bewegungszustand, der erst
durch Übergangsaktionen "beruhigt" werden muss. Besondere Bedeutung
erhalten die Aktionen in der Endphase aus dreierlei Gründen. Ein erster
Grund ist die Sicherheit. Wer eine Latte oder ein Pferd übersprungen
und wer eine Saltodrehung ausgeführt hat, der darf sich noch nicht
"zur Ruhe setzen". Er muss sich, um Verletzungen zu vermeiden, auch noch
um den Übergang in einen sicheren Stand bzw. um eine ungefährliche
Landung kümmern.
Dies
trifft auch in jenen Sportarten zu, bei denen das Landen selbst zu der
eigentlichen Bewegungsaufgabe nicht mehr gerechnet werden darf. Ein zweiter
Grund liegt in den jeweils vorgegebenen Wettkampfregeln. Bekanntlich darf
man beim Kugelstoßen, beim Speer-, Diskus- oder Hammerwerfen, aber
auch beim Aufschlag im Tennis oder beim Wurf auf das Tor im Handball nicht
"übertreten". Diese Regelvorschriften bedingen, dass auch noch den
Aktionen, die nach Erledigung der eigentlichen Bewegungsaufgabe auszuführen
sind, Beachtung geschenkt wird. Ein dritter Grund für die Bedeutung
der Endphase betrifft den Übergang zu neuen oder die Wiederholung
von bereits ausgeführten Bewegungen. Wenn wir an einen Umschwung vorwärts
vorlings oder an einen Kippaufschwung eine Hocke anschließen wollen,
dann muss der Endphase des Umschwungs oder der Kippe bereits die Vorbereitungsphase
der Hocke überlagert sein. Dasselbe gilt, wenn wir wie etwa beim Torlauf
an einen Schwung gleich einen zweiten anfügen müssen. Auch hier
ist beim "Aussteuern" des ersten bereits der Beginn des nächsten Schwungs
vorzubereiten. Und es gilt schließlich - wie schon angedeutet - für
alle zyklischen Bewegungsabläufe, für die das Zusammenfallen
von Vorbereitungs- und Endphase charakteristisch und mit dem Begriff der
Phasenverschmelzung gekennzeichnet ist."
(U. Göhner:
Prinzipien zur Analyse sportlicher Bewegungen. In:Sport - Theorie
in der gymnasialen Oberstufe, S. 119 ff)
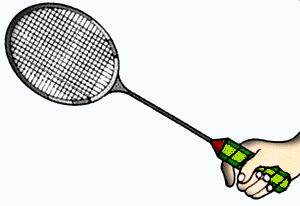 
|
|